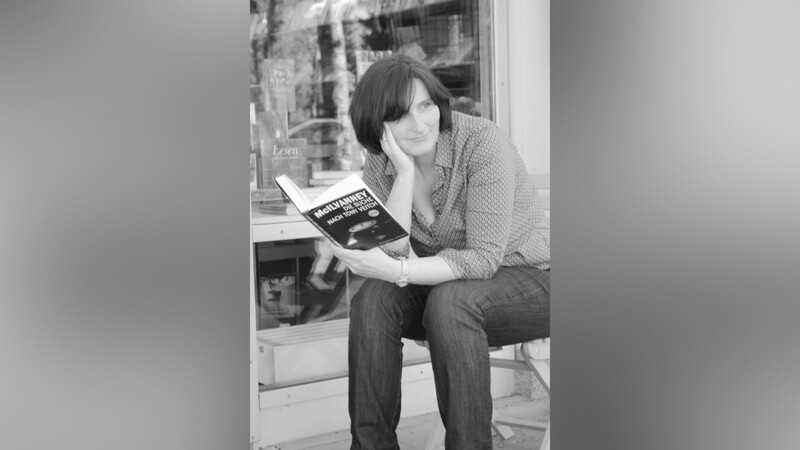Neuerscheinung
Pierre Jarawan über seinen neuen Roman „Ein Buch für die Vermissten“
1. März 2020, 18:02 Uhr aktualisiert am 1. März 2020, 18:02 Uhr

Marvin Ruppert
Pierre Jarawan, geboren 1985 in Amman (Jordanien), ist ein deutscher Schriftsteller und Slam-Poet.
Der Münchner Autor Pierre Jarawan stellt seinen neuen Roman "Ein Buch für die Vermissten" vor
Fünfzehn Jahre dauerte der libanesische Bürgerkrieg, ehe er 1990 befriedet wurde. Immer noch ist das Schicksal von über 17 000 Menschen ungeklärt. Aus der ehemals mondänen "Schweiz des Orients" ist ein permanenter Krisenherd geworden, der nun auch wirtschaftlich vor dem Ruin steht. Der Münchner Schriftsteller Pierre Jarawan schrieb 2016 mit seinem Debütroman "Am Ende bleiben die Zedern" über eine Identitätssuche zwischen Deutschland und dem Libanon.
Nach dem großen internationalen Erfolg stellt Pierre Jarawan nun "Ein Lied für die Vermissten" vor. Es ist die Geschichte des jungen Amin, der mit seiner Großmutter im Alter von 13 Jahren von München in den Libanon zurückkehrt, in ein ihm zunächst fremdes Land. Dort wird er auch auf die Geschichte seiner Eltern stoßen, die vermeintlich bei einem Autounfall starben, als Amin noch ein Baby war. Auf mehreren Zeitebenen erzählt Pierre Jarawan souverän und warmherzig von den Wunden des Krieges, verdrängten Traumata und dem Lebensgefühl einer Generation mit beschränkter Hoffnung.

Pierre Jarawan
Beirut wurde in den letzten Jahrzehnten zwei Mal zerstört und wieder aufgebaut.
AZ: Herr Jarawan, Sie haben eine sechswöchige Lesereise durch die USA hinter sich, große Promotouren in Frankreich und Holland, wo Ihr Debüt ein riesiger Bestseller war. Haben Sie eine Erklärung für den außergewöhnlichen Erfolg Ihres Debüts, das bislang in sechs Sprachen übersetzt wurde?
PIERRE JARAWAN. Ich glaube, dass es mehrere Gründe gibt. Der Roman, und das zeigen auch die Leserbriefe, die ich bekomme, spricht Männer und Frauen, Ältere und Jüngere gleichermaßen an. Ich bekomme Resonanz von Menschen mit Migrationshintergrund, egal aus welchem Land, und auch von Lesern, die zwar keinen Migrationshintergrund haben, aber empathisch sind. Es gibt auch einfach Leser, die groß erzählte Geschichten lieben, in denen man versinken kann. Ich habe beim Schreiben ganz sicher nicht auf Massentauglichkeit geschielt, aber wenn ich es jetzt mit Abstand betrachte, ist es doch ein Buch, das erstaunlich viele Menschen anspricht.
Was schreiben Ihnen denn die Leser?
Erstaunlicherweise bedanken sie sich für schöne Lesestunden, dabei bin ich ja zu Dank verpflichtet. Menschen mit Migrationshintergrund schreiben mir ganz oft, dass sie sich in der von mir beschriebenen Zerrissenheit zwischen den zwei Kulturen wiedergefunden haben, dieses Gefühl, nirgendwo richtig angekommen zu sein.
Sie selber haben diese Zerrissenheit aber im eigenen Leben gar nicht so gespürt.
Nein, aber es gab schon den Punkt, als ich realisieren muste, dass der Libanon, wie ich ihn über die Jahre bei meinen Familienbesuchen kennengelernt hatte, als Paradies auf Erden, nicht existiert. Ich sage auch bei meinen Lesungen, dass ich privilegiert bin: Meine Mutter ist Deutsche, ich hatte nie Sprachschwierigkeiten, als ich im Alter von drei Jahren nach Deutschland kam. Ich habe nie Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit gemacht. Man sieht mir ja auch nicht an, dass ich einen libanesischen Vater habe. Ich habe immer das beste aus beiden Welten gehabt. Aber eines hat sich durch den Roman schon geändert: Früher war ich ein Deutscher, plötzlich bin ich in der Wahrnehmung vieler ein deutsch-libanesischer Schriftsteller, was ich vorher nie war.
Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis, das dazu führte, den Libanon in Ihren Romanen zu thematisieren?
Das ist eher ein Gefühl, das gewachsen ist. Ich habe mit 13 angefangen zu schreiben, denn ich wollte immer einen Roman schreiben. Der Poetry-Slam war später eher ein Umweg und eine gute Schule. Ich habe auch mit 18 Jahren versucht, einen Roman zu schreiben, aber das ist Unfug. Ich habe gerne Romane gelesen, deswegen wollte ich selber einen schreiben, aber ich hatte keine Geschichte. Aus dem Bedürfnis, mehr über die Geschichte des Libanon zu erfahren, sind dann die Ideen für den ersten und auch den zweiten Roman entstanden. Ich habe mir oft gedacht: Wieso weiß man das nicht, was dort vorgefallen ist? 2015 habe ich dann erstmals eine richtige Recherchereise in den Libanon unternommen und auch die Menschen kennengelernt, die dort die Vermissten dokumentieren.
Dieser Teil der libanesischen Vergangenheitsbewältigung ist rein privat organisiert?
Es gibt keine staatliche Unterstützung dafür, es gibt ja auch kein staatliches Interesse an der Aufklärung. Die Mörder des Bürgerkriegs oder deren Nachkommen stehen noch immer an der gesellschaftlichen Spitze des Landes. Und dann argumentieren sie gegenüber der Bevölkerung so, dass jedes neu entdeckte Massengrab mit Toten einer Konfession unweigerlich zu Racheakten führen würde.
An einer Stelle heißt es in Ihrem neuen Roman: "Nicht Vergeben ermöglicht Zusammenleben, sondern Schweigen."
Das ist die Argumentationslinie der Regierung. Die spielen viel mit der Angst der Bevölkerung vor einem neuen Bürgerkrieg. Die Macht des Narrativs hat niemand, es gab ja keinen Sieger, der die Geschichte hätte schreiben können. Und deswegen gibt es von 17 verschiedenen Religionsgemeinschaften 17 unterschiedliche Betrachtungen des Krieges. Das Nationalmuseum zeigt Ausstellungsstücke der Phönizier und des Osmanischen Reiches, aber die Geschichte der zweiten Hälfte die 20. Jahrhunderts ist nicht existent.
In Ihrem neuen Roman "Ein Lied für die Vermissten” widmen Sie sich dem Thema der 17 000 Verschwundenen. Sie erzählen, was es psychologisch mit Familien macht, die mit einer Leerstelle leben müssen.
Ich habe damals gemerkt, dass dieses Thema der Vermissten zu groß ist, um es noch in meinem ersten Roman angemessen abzuhandeln. Das ist ein eigenes, riesengroßes Thema, das bis in die Gegenwart wirkt. Die Menschen, die in den 70er oder 80er Jahren verschwunden sind, fehlen immer noch. Das ist eine Leerstelle im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft und in den betroffenen Familien natürlich eine Wunde, die nicht heilt. Auch, weil es keine Gewissheiten gibt. Und niemand spricht offen darüber. Ich habe in den Archiven auch Tonbandprotokolle gehört, die ich im Roman zitiere. Es sind Stimmen von Frauen, die auch teilweise deswegen geächtet werden, weil sie die Menschen daran erinnern wollen, was geschehen ist. Das hat mich sehr bewegt. Mir geht es in dem Roman um ein Sichtbarmachen. Ich glaube, wenn etwas passiert, ohne dass man davon erzählt, dann verschwindet das. Das darf nicht passieren. Das Schöne an Literatur ist, dass sie zum Erinnern zwingen kann. Genau das habe ich mit meinem Roman versucht.
Gemeinhin gilt das zweite Buch als das schwierigste, vor allem natürlich, wenn das erste so erfolgreich war.
"Am Ende bleiben die Zedern" habe ich in acht Monaten geschrieben, nachdem ich recherchiert hatte. Ich dachte also beim Beginn der Arbeit an "Ein Lied für die Vermissten”, es würde wieder acht Monate dauern, einen Roman zu schreiben. Aber ich habe dreieinhalb Jahre gebraucht!
Weil Ihr Anspruch an Sie selbst gewachsen ist?
Ja, natürlich, ich wollte mich ja nicht wiederholen und auch zeigen, dass ich etwas gelernt habe. Es ist ein bisschen Fluch und Segen bei mir, dass ich besessen davon bin, immer besser zu werden. Das führte dann auch dazu, dass sich das Buch beim Schreibprozess völlig verändert hat. Ich habe insgesamt 350 Seiten gelöscht, weil die Erzählperspektive so nicht funktioniert hat. Ich habe aber auch gemerkt, dass es mir inzwischen besser gelingt, komplexe Dinge einfacher zu beschreiben.
Der Bürgerkrieg wurde 1990 beendet, aber als Amin 2006 vor seinem Haus steht, sieht er schon wieder Kampflugzeuge, diesmal israelische.
Alles kehrt immer an seinen Ausgangspunkt zurück, das ist im Grunde genommen so sein Fazit. Das Buch beginnt 2006, da wird die Stadt gerade in einem neuen Krieg zerstört, drei Jahre später küren westliche Medien Beirut zur Stadt des Jahres, 2011 gibt es dann wieder Probleme. Der Libanon war eigentlich gar nicht vom Arabischen Frühling betroffen, aber 2011 ist dort trotzdem eine Zeitenwende. Bis dahin waren es immer Libanesen, die nach Syrien oder in die ganze Welt geflohen sind. 2011 dreht sich das um. Schon bald kommen die ersten Flüchtlinge aus Syrien, und es wurden Millionen.
Könnten Sie auch einen Roman über das München von heute verfassen?
Dafür müsste ich wohl in den Libanon gehen, um zumindest räumliche Distanz zu haben und auf Deutschland zurückzuschauen. Ich brauche entweder räumliche oder zeitliche Distanz zu dem, über das ich schreibe. Das ist auch der Grund, warum Geschichte in beiden Romanen eine so große Rolle spielt. Wir können die Gegenwart ja auch gar nicht begreifen, wenn wir die Geschichte nicht kennen.
Pierre Jarawan stellt "Ein Lied für die Vermissten" (Berlin Verlag, 462 Seiten, 22 Euro) am Montag, 2. März, um 20 Uhr im Literaturhaus vor, dazu zeigt er seine Fotos aus dem Libanon, der Perkussionist Murat Coskun begleitet ihn, Karten unter Telefon 01806 700 733