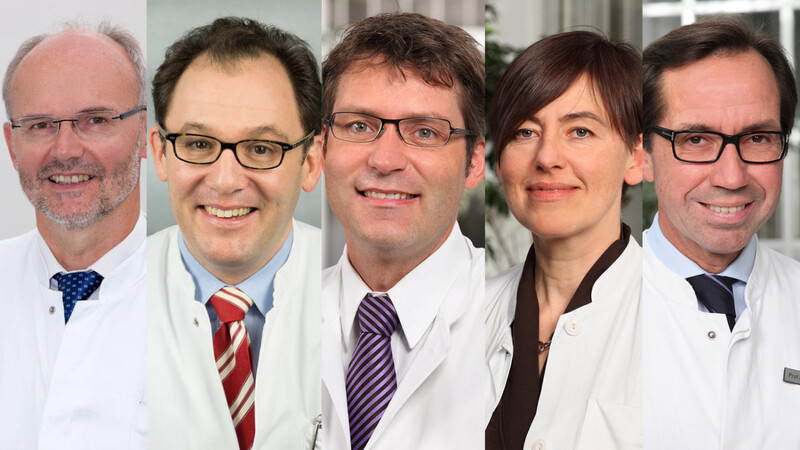Klarheit über Down-Syndrom durch Bluttest?
Eine Pränatalmedizinerin bringt Licht ins Dunkel
23. September 2019, 17:00 Uhr aktualisiert am 23. September 2019, 17:00 Uhr

Caroline Seidel/dpa
Gen-Untersuchungen bei ungeborenen Kindern sind seit Jahren heftig umstritten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kassen und Kliniken macht nun den Wegbereiter. (Symbolbild)
Gen-Untersuchungen bei ungeborenen Kindern sind seit Jahren heftig umstritten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kassen und Kliniken macht nun den Wegbereiter. Denn schwangere Frauen sollen entsprechende Bluttests (NIP-Tests) auf ein Down-Syndrom des Kindes künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt bekommen. Allerdings nur in begründeten Einzelfällen für Frauen mit Risikoschwangerschaften. Zu diesem Thema haben wir bei der Pränatalmedizinerin Dr. Ute Germer am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg nachgefragt.
Frau Dr. Germer, welche Haltung hat man am Caritas-Krankenhaus St. Josef zu Gen-Untersuchungen bei ungeborenen Kindern?
Dr. Ute Germer: Die Grundhaltung ergibt sich aus dem Leitbild der Caritas. "Jeder Mensch ist einmalig als Person und besitzt eine ihm von Gott gegebene unverfügbare Würde. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, menschliches Leben von Anfang bis Ende, von der Empfängnis bis zum Tod, zu achten, zu schützen und wo Not ist, helfend zu begleiten. Vornehmstes und ureigenstes Ziel aller Caritas-Arbeit ist es, Menschen, insbesondere benachteiligte und schwache, vor Ausnutzung, Ausgrenzung und vor Vereinnahmung zu schützen und ihre Selbsthilfekräfte anzuregen." Das gilt auch für werdende Eltern und ungeborene Kinder am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, durch diese Bluttests Kinder mit Down-Syndrom "vorhersagen" zu können?
Dr. Germer: Screeningtests oder Reihenuntersuchungen für Trisomie 21, wie das Ersttrimesterscreening mit Messung der Nackenfalte, sind seit vielen Jahrzehnten verfügbar. Rein theoretisch können damit auch schon 85 bis 90 Prozent aller Schwangerschaften mit Trisomien pränatal entdeckt werden. Das passiert aber nicht, da die Mehrheit der Frauen in Deutschland (schätzungsweise zwei Drittel) die Tests nicht durchführen lässt. Im Vergleich zu diesem Ersttrimesterscreening ist die Entdeckungsrate des NIP-Tests für die Trisomie 21 mit 99 Prozent höher. Das heißt, in 99 von 100 Schwangerschaften mit Trisomie 21 zeigt dieser Test ein positives Ergebnis.
Ist dadurch also ein entsprechender Anstieg der pränatal entdeckten Trisomien zu erwarten?
Dr. Germer: Nein, da der NIP-Test nur in begründeten Einzelfällen als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen erfolgen soll. Daher ist ein relevanter Anstieg kaum zu erwarten.
"Testergebnis darf nicht als endgültige Diagnose missverstanden werden"
Wenn also ein solcher NIP-Test ein derart eindeutiges Ergebnis zeigt, ist dies automatisch gleichbedeutend mit einer absoluten Gewissheit für die werdenden Eltern?
Dr. Germer: Ein positives Testergebnis im NIP-Test ist keinesfalls beweisend für eine Trisomie beim Ungeborenen, da der Test nicht den Feten, sondern lediglich Anteile des Mutterkuchens untersucht. Dieser kann auch bei gesunden Feten von Chromosomenstörungen betroffen sein. Deshalb ist ein positives Ergebnis im NIP-Test Anlass für eine Ultraschalluntersuchung mit anschließender Fruchtwasserentnahme oder Punktion des Mutterkuchens. Ein positives Ergebnis im NIP-Test darf also nicht als endgültige Diagnose missverstanden werden.
Die Leistung der gesetzlichen Krankenkassen soll ja nur in "begründeten Einzelfällen" erfolgen. Ist diese Definition nicht sehr vage?
Dr. Germer: Man kann die Begründung als vage empfinden, aber sie erlaubt der Schwangeren und dem behandelnden Frauenarzt einen Ermessensspielraum als Voraussetzung für eine individuelle Beratung und Entscheidung. Das ist sicher im Sinne der werdenden Eltern und von deren Vorteil.
Droht dadurch nicht auch ein unüberschaubarer bürokratischer Aufwand für Ärzte und Kliniken, um festzulegen, wann ein solcher "begründeter Einzelfall" vorliegt?
Dr. Germer: Der bürokratische Aufwand ist abhängig von den konkreten Bedingungen und der organisatorischen Umsetzung der Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Da es sich beim NIP-Test in der Regel um eine Leistung aus dem ambulanten Sektor handelt, werden die Kliniken dabei weniger beansprucht als die Frauenärzte.